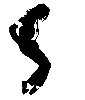"Dear Brother" - "Geliebter Bruder"
"Walking the roads of our youth, through the land of our childhood." -
"Wir laufen die Pfade unserer Jugend entlang, durch das Land unserer Kindheit."
"Always stay beside me so I can be free." -
"Bleib immer an meiner Seite, damit ich frei sein kann."
"And promise me from heart to chest to never let your memories die. Never." -
"Und versprich mir vom Herzen bis zur Brust, dass du deine Erinnerungen nie sterben lassen wirst. Niemals."
"I'll always be alive and by your side. In your mind. I'm free." -
"Ich werde immer am Leben und an deiner Seite sein. In deinen Gedanken. Ich bin frei."
Der wahrscheinlich emotionalste Werbespot des ganzen Jahres stammt von zwei deutschen Studenten der Filmakademie Baden-Württemberg. Laut "Welt" sei der Spot nicht vergütet worden und werde bereits als beste Johnnie-Walker-Werbung aller Zeiten gehandelt.